Idee
Wir sind ein Zusammenschluss aus Initiativen und Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sich das Tempelhofer Flughafengebäude in den nächsten 20 Jahren zum solidarischen und zukunftsfähigen Stadtteil entwickelt und wir laden die Bürger*innen ein, das Gebäude zum Feld kennenzulernen, sich in den Prozess einzubringen und von- und miteinander zu lernen, wie der Flughafen schon jetzt Stück für Stück ein Ort für alle werden kann.
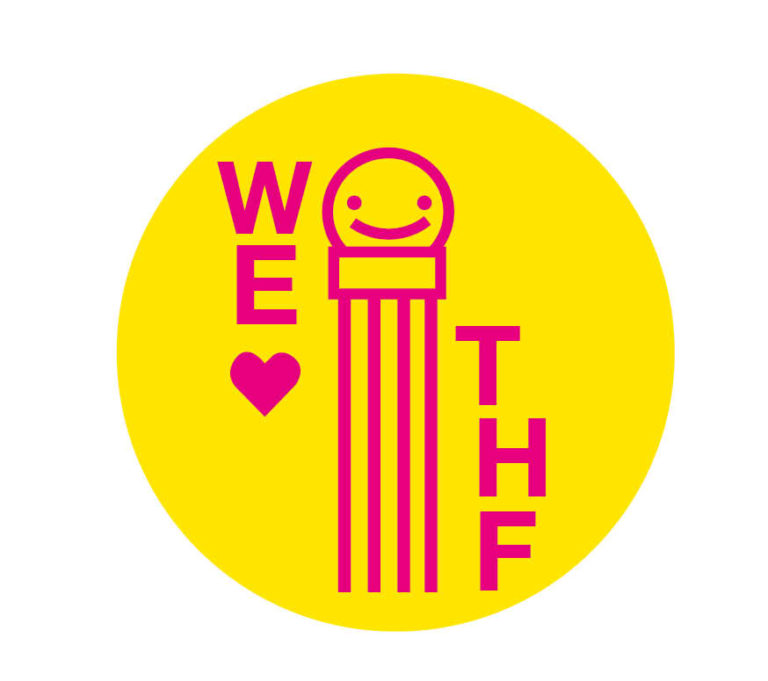
Recht auf Zukunft
Alle Menschen haben ein Recht auf Zukunft. Damit dieses Recht für gegenwärtige und zukünftige Generationen geschützt werden kann, müssen wir uns so schnell und effizient wie möglich mit den Herausforderungen unserer Zeit befassen (vgl. 17 Nachhaltigkeitsziele der UN).
Soziale Bewegungen wie „Fridays For Future“ zeigen aktuell, dass die Forderung nach einem „Recht auf Zukunft“ viele Menschen bewegt und deswegen ganz oben auf der Agenda des öffentlichen und politischen Diskurses stehen sollte. Die Lebensqualität aller Menschen wird in Zukunft entscheidend davon abhängig sein, wie wir mit den Herausforderungen unserer Zeit umgehen. Sie kann nur dann gewahrt werden, wenn Klimaziele erreicht und demokratische und solidarische Strukturen gestärkt werden. Das schließt Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Minderheiten genauso ein, wie die erfolgreiche und verantwortungsvolle Integration von Geflüchteten und Neuankömmlingen. Die Frage, wie wir diese Ziele in Städten wie Berlin erreichen und sie nachhaltig, menschenfreundlich und ressourcenschonend gestalten können, beschäftigt viele Bürger*innen: Wie schaffen wir es, dass Städte lebenswerte Orte für alle Menschen werden und bleiben?
Das Tempelhofer Flughafengebäude bietet aufgrund seiner Größe und Lage wertvolle Möglichkeiten, sich dieser Herausforderungen ganz praktisch zu widmen. Noch stehen knapp 120.000m² der vermietbaren Fläche des 312.000m² großem Gebäudes leer (vgl. rote Nr. 1391-A, April 2019).
Auch die Geschichte des Flughafens sollte bei der verantwortungsvollen Planung der Nachnutzung berücksichtigt werden: Der Tempelhofer Flughafengelände beherbergte zunächst von 1933 bis 1934 ein Gefängnis der Gestapo, das 1934 zum Konzentrationslager umfunktioniert wurde – das einzige offizielle SS-Konzentrationslager Berlins und eines der ersten Konzentrationslager überhaupt. Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm die US-Luftwaffe den Flughafen. 1948 diente er während der Blockade West-Berlins durch die Sowjetunion der Versorgung Westberlins mit lebensnotwendigen Gütern über den Luftweg und war damit der Dreh- und Angelpunkt der sogenannten „Luftbrücke“. Damit galt er für viele West-Berliner*innen als „Tor zur freien Welt“.
Aus der Geschichte des Ortes folgt die Verantwortung, sich seiner mit Sensibilität und einem besonderen Bewusstsein für seine schwierige Vergangenheit anzunehmen. Wir wünschen uns, dass der Tempelhofer Flughafen ein Ort wird, der die Bedürfnisse und Lebensrealitäten aller Berliner*innen berücksichtigt – auch der marginalisierten Gruppen, die bei der Stadtplanung oft vernachlässigt werden.
Was zunächst utopisch erscheint, ist bei näherer Betrachtung durchaus umsetzbar: Das Flughafengebäude und seine Entwicklung sollen laut Koalitionsvertrag mit den Bürger*innen Berlins entwickelt werden und bereits während der Sanierung Nutzungen ermöglichen. Wie genau dieses Partizipationsverfahren zukünftig weiterlaufen wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt jedoch internationale Beispielprojekte und Expert*innen, von denen wir für den THF lernen können.
Die Zukunft beginnt jetzt!
(07.08.2019, Irina Christiani, Mona Saddei, Jule Hanske)

Feld und Gebäude
Seit seiner Öffnung für alle Bürger*innen Berlins im Jahr 2010 ist das Tempelhofer Feld in den vergangenen Jahren zu einem inoffiziellen Wahrzeichen der Stadt geworden und hat weltweite Bekanntheit erlangt. Mit einer Größe von ca. 300 Hektar ist es weltweit eine der größten innerstädtischen Grünflächen und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die von Tourist*innen und den Bürger*innen Berlins gerne angenommen werden.
Während alle das Tempelhofer Feld kennen, scheint das Flughafengebäude – das Gebäude zum Feld – nahezu unsichtbar zu sein: Ein Zaun um das fast 250.000m² große betonierte Vorfeld grenzt die Sicht auf das Flughafengebäude ein und blockiert den direkten Zugang.
Dabei bietet das Gebäude zum Feld, welches dem Land Berlin gehört, noch viel Freiraum (120.000 m²), der in den nächsten Jahren für und mit den Berliner*innen entwickelt werden soll (vgl. Koalitionsvertrag). Bislang ist die Gestaltung des Flughafengebäudes im Gegensatz zur Gestaltung des Feldes nur selten Gegenstand des öffentlichen und politischen Diskurses.
Mobilität, Logistik, Zugänge zum Feld, eine ökologisch nachhaltige Sanierung, ein soziales und gemeinwohlorientierte Nutzung erlaubendes Finanzkonzept, Barrierefreiheit, der Umgang mit der Geschichte und eine prozessorientierte partizipative Stadtentwicklung sind nur eine Auswahl an Themen, die gemeinsam mit der Bevölkerung diskutiert werden müssen, wenn man die Beteiligung der Bürger*innen ernst meint.
Rund 740.000 Berliner*innen haben im Mai 2014 im Rahmen eines Volksentscheids dafür gestimmt, dass das Tempelhofer Feld in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt und sich damit gegen eine mögliche Randbebauung entschieden. Trotzdem wird die Diskussion über eine Bebauung des Feldes immer wieder angestoßen. Das Argument der Befürworter*innen ist der (Wohn-)Raummangel in Berlin.
Das Flughafengebäude spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz und Erhalt des Feldes – denn hier findet sich bereits Raum, der durch die Bebauung des Feldes erst geschaffen werden soll. Für eine langfristige Öffnung des Flughafengebäudes braucht es Erhebungen, Analysen, Möglichkeiten zum Ausprobieren und eine stufenweise Entwicklung. Hier braucht es menschen- und umweltfreundliche Lösungen, die die Bürger*innen Berlins genauso wie Expert*innen in einem transparenten und öffentlichen Partizipationsverfahren einbeziehen.
Gebäude und Feld müssen zusammengedacht werden. Die Nutzung des Flughafens im Sinne eines lebendigen Stadtteils bietet vielfältige Möglichkeiten das Gebäude ergänzend zum Feld zu gestalten und so den Freiraum des Feldes zu erhalten und wertzuschätzen.
(07.08.2019, Irina Christiani, Mona Saddei, Jule Hanske)


